Als Literaturwissenschaftlerin in einem Tech-Startup
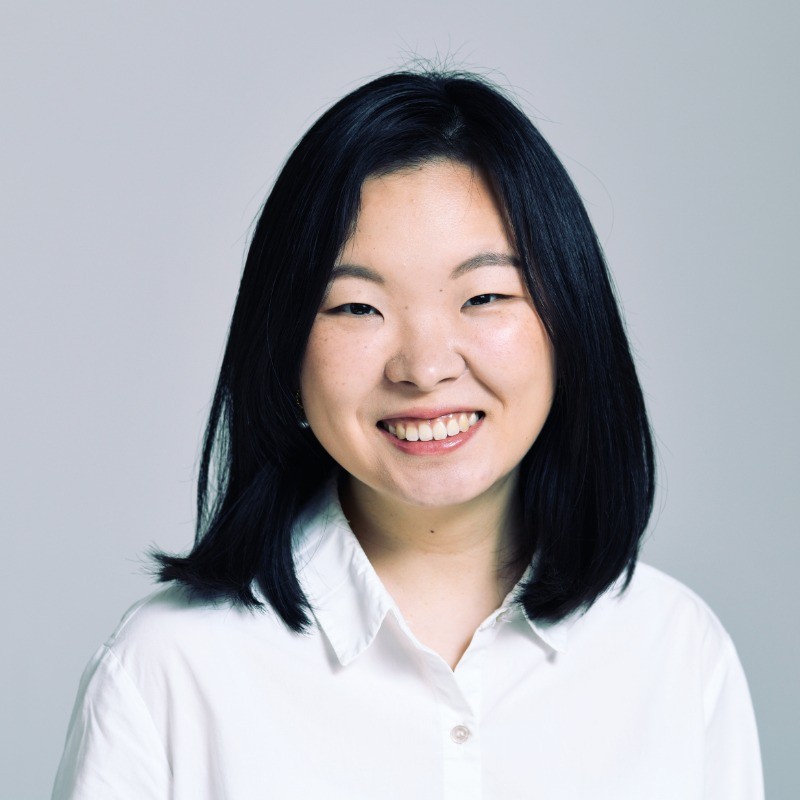
von
Dr. Sang-Yu Ma
| 13.09.2025
Der große Schritt
Ich habe im Jahr 2024 meine Promotion im Fach Neuere deutsche Literaturwissenschaft abgeschlossen. Ursprünglich hatte ich die ambitionierte Vorstellung, eine akademische Karriere anzustreben. Doch ich hatte zu große Zweifel an mir und an meinem Können. Gleichzeitig hatte ich bedingt durch gesundheitliche Herausforderungen auch große Angst und Respekt vor der Entscheidung, weiterzuschreiben und zu forschen. Dennoch habe ich mich in den ersten Monaten nach meinem Abschluss nach Postdoc-Stipendien erkundigt, mich in ein mögliches neues Forschungsthema eingelesen und erste Projektskizzen geschrieben, weil ich nicht loslassen konnte. In dieser Zeit hielt ich mich mit Minijobs über Wasser und griff auf meine Ersparnisse zurück. Ich lebte zwar sehr sparsam, aber mein Kontostand sank drastisch und meine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland lief bald ab. So musste ich einen Entschluss fassen und tastete mich an das Thema Arbeitssuche heran; völlig erfolglos. Zeitweise dachte ich sogar ernsthaft übers Taxifahren nach, obwohl ich nicht einmal einen Führerschein habe.
Arbeitssuche mit Ach und Krach
Bei der Jobsuche stieß ich auf mehrere Herausforderungen, die nicht nur auf meinen Mangel an praktischer Arbeitserfahrung zurückzuführen waren, sondern auch auf fehlendes Wissen über die Arbeitskultur und den Verhaltenskodex in Deutschland. Zwar hatte ich meine Kindheit hier verbracht, aber mit Fragen wie „Wie erstellt man einen präsentablen Lebenslauf?“, „Welche Unterlagen gehören in die Bewerbungsmappe?“, „Was ist ein Anschreiben“, „Worüber wird in einem Vorstellungsgespräch gesprochen?“ und „Wie soll ich mich dort verhalten?“ kommt man als Grundschulkind üblicherweise nicht in Berührung. Mit diesen grundlegenden Fragen musste ich mich also erstmals intensiver befassen. Dafür bat ich meine Freund*innen um Feedback, die bereits in unterschiedlichsten Branchen Fuß gefasst hatten. Ich dachte, ich hätte damit eine große Hürde überwunden.
Tja, dann kam aber noch eine andere. In dieser Zeit hätte ich gerne, wie viele andere Suchende in Online-Foren erzählen, täglich zwanzig Bewerbungen abgeschickt, um meine Chancen zu erhöhen. Doch wie zum Teufel soll ich denn jeden Tag so viele Bewerbungen abschicken, wenn es kaum Stellen gibt, die zu meinem Profil passten und in meiner Region angeboten werden? Ich beschränkte meine Suche auf das Rhein-Main-Gebiet, weil mir das Zusammenleben mit meinem Partner sehr wichtig war. Eine Stelle in Berlin oder Köln kam also nicht infrage. Morgens verbrachte ich stundenlang auf LinkedIn, Indeed, Stepstone und insbesondere Kultweet, drückte auf F5, aber, ach herrje!
Dazu erschwerten mein geisteswissenschaftlicher Hintergrund und meine vermeintliche „Überqualifizierung“ den Einstieg ins Berufsleben. In mehreren Vorstellungsgesprächen wurde mein Doktortitel thematisiert, gepaart mit der unausweichlichen Frage, ob ich für die Stelle nicht überqualifiziert sei; die Arbeit würde mich nur langweilen, sodass ich die Stelle in Kürze wieder verlassen würde. „Naja, ist es aber nicht Beweis genug, dass ich Langeweile-resistent bin, wenn ich die 1330 Fußnoten in meiner Doktorarbeit überstanden habe?“, dachte ich und verdrehte auf dem Weg nach Hause die Augen. Nicht selten kam auch die Frage auf, ob ich ein gutes Gespür für Zahlen hätte. Ich nickte zwar, aber mein Lebenslauf sprach dagegen.
Der Wendepunkt
Als das Wetter sommerlicher wurde und die Urlaubssaison heranrückte, wuchs meine Angst. Ich wusste, dass in dieser Zeit weniger Stellen ausgeschrieben werden. Aus Trotz, Frust und Verzweiflung begann ich, meine Unterlagen unabhängig vom Inhalt der Stellenanzeigen zu verschicken. Dort stand ungefähr drin: „Believe it or not – ich bringe ein Kompetenzset mit, bestehend aus Sprach- und Kulturkompetenzen, starker Kommunikationsfähigkeit, wissenschaftlicher Expertise. Auch kritisches und analytisches Denken, Recherche-Skills und Schreib- und Lesekompetenz, schnelle Auffassungsgabe, Sorgfalt und Geduld gehören zu meinen Stärken“ Ich kam mir dabei vor wie eine Person, die auf der Straße Flyer verteilt.
Damit erreichte ich aber überraschenderweise mehr Arbeitgeber als zuvor und unterschrieb schließlich den Vertrag bei meinem jetzigen Arbeitgeber, der Desion GmbH. Desion ist ein Start-up-Unternehmen, das mit dem Fraunhofer-Institut und der TU Darmstadt kooperiert. Spezialisiert auf visuelle Textilinspektion, entwickelt es hochinnovative Maschinen, die mithilfe von KI und Robotik in Textilfabriken und Wäschereien für die Qualitätskontrolle eingesetzt werden oder in Altkleideranlagen den Sortiervorgang automatisieren.
Angefangen habe ich bei Desion als „Assistentin der Geschäftsleitung“, ließ jedoch zwei Wochen nach Eintritt die Berufsbezeichnung in „Referentin für Kommunikation und Unternehmensprozesse“ ändern, weil meine Aufgaben über die klassischen Tätigkeiten einer CEO-Assistentin hinausgingen und ich mich mit dieser Bezeichnung nicht identifizieren konnte. Heute bin ich nicht nur für alltägliche Verwaltungsaufgaben zuständig, sondern übernehme auch die interne Kommunikation zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitenden. Außerdem schreibe ich Anträge für Fördermittelakquise und werde für die externe Kommunikation mit Stakeholdern im Bereich des Technical Writing eingesetzt. So verfasse ich Produktbeschreibungen und lektoriere Texte meiner Kolleg*innen. Bei diesen Aufgaben profitiere ich sehr stark von meiner Expertise im Schreiben, auch wenn es eine Herausforderung ist, mein Fachvokabular im Bereich digitaler Technologien zu erweitern. Gleichzeitig befasse ich mich derzeit damit, im Bereich People & Culture neue Strukturen im Unternehmen zu schaffen und bestehende Prozesse zu optimieren. Besonders weil Menschen aus aller Welt bei uns beschäftigt sind und unterschiedliche Kulturen sowie Lebenserfahrungen aufeinandertreffen, kommen mir meine interkulturelle Sensibilität und Diversity-Kompetenz zugute. Ich schätze diese persönlichen Begegnungen mit meinen Kolleg*innen sehr, denn jedes Gespräch erweitert meinen Horizont.
Es fällt mir auf, dass man in Tech-Unternehmen als Geistes- und Sozialwissenschaftler*in eigentlich viele Kompetenzlücken füllen kann. Ich kann zwar nicht programmieren oder Maschinen bauen, aber dafür sehr gut schreiben, komplizierte Sachverhalte verständlich aufbereiten und kommunizieren, analytisch denken, technische Entwicklungen in soziopolitisch-kulturelle Kontexte verorten, kritisch reflektieren und anhand dessen zukunftsweisend Prognosen stellen; Kompetenzen, die auch im Tech-Bereich erforderlich sind. Ich finde es sehr schade, dass diese Fähigkeiten oft nicht ernst genommen werden und geistes- und sozialwissenschaftliche Expertise auf dem Arbeitsmarkt häufig nicht als solche anerkannt wird. Doch schließlich kommt es genau auf diese Fähigkeiten an, wenn wir höchst innovative Technologien nicht nur entwickeln, sondern auch in die Gesellschaft hineintragen wollen.
